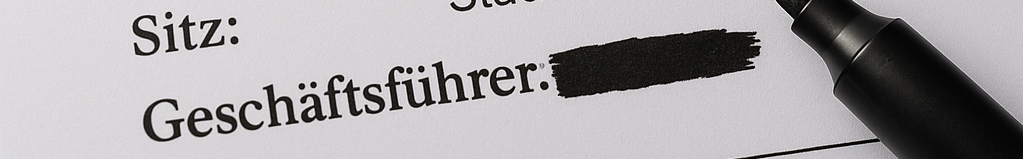
§ 266a StGB: Arbeitgeber oder nicht? Die Strafbarkeit des GmbH-Geschäftsführers
15. Mai 2025
Die Strafbarkeit nach § 266a StGB trifft nur den Arbeitgeber – doch welcher Geschäftsführer ist das? In Ermittlungsverfahren wegen Vorenthaltens von Arbeitsentgelt steht die Frage im Zentrum, wer bei § 266a StGB als Arbeitgeber gilt und welcher Geschäftsführer strafrechtlich haftet.
Die Abgrenzung zwischen formeller Organstellung und tatsächlicher Arbeitgeberverantwortung entscheidet über die Strafbarkeit. Dieser Beitrag analysiert die rechtlichen Grundlagen, die aktuelle BGH-Rechtsprechung und entwickelt Verteidigungsansätze für die Praxis.
§ 266a StGB: Der Arbeitgeber als alleiniger Täter
Bei § 266a StGB handelt es sich um ein echtes Sonderdelikt: Täter kann nur der Arbeitgeber sein. Der BGH hat in seiner jüngsten Rechtsprechung die Definition des Arbeitgebers bei § 266a StGB präzisiert:
„Arbeitgeber i. S. des § 266a StGB ist derjenige, dem gegenüber der Arbeitnehmer zur Erbringung von Arbeitsleistungen gegen Entgelt verpflichtet ist und zu dem er in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis steht, das sich vor allem durch die Eingliederung des Arbeitnehmers in den Betrieb des Arbeitgebers ausdrückt. Das Bestehen eines solchen Beschäftigungsverhältnisses zum Arbeitgeber bestimmt sich dabei nach den tatsächlichen, in eine Gesamtbetrachtung einzustellenden Gegebenheiten.“
BGH, Urt. v. 14.6.2023 – 1 StR 74/22
Diese Definition des Arbeitgebers bei § 266a StGB stellt auf die tatsächlichen Verhältnisse ab. Die strafrechtliche Bestimmung orientiert sich damit nicht primär an formalen Kriterien, sondern an der faktischen Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses. Eine rein formale Stellung als Geschäftsführer begründet noch keine automatische Arbeitgebereigenschaft im Sinne des § 266a StGB.
Wann haftet der Geschäftsführer nach § 266a StGB? BGH-Rechtsprechung zur Arbeitgebereigenschaft
Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat die Verantwortlichkeit von GmbH-Geschäftsführern kontinuierlich ausgeweitet. Der BGH betont in ständiger Rechtsprechung (zuletzt BGH, Urt. v. 08.01.2020 – 5 StR 122/19):
„Der Geschäftsführer muss Anhaltspunkte für Pflichtverstöße erkennen und bei Bedarf eingreifen – auch wenn ein faktischer Geschäftsführer vorrangig agiert.“
Diese Rechtsprechung etabliert eine doppelte Verantwortungsebene: Die Primärverantwortung trägt der handelnde (faktische) Geschäftsführer, während dem formellen Geschäftsführer eine Sekundärverantwortung kraft Überwachungspflicht zukommt.
Die Delegation von Aufgaben entlastet den formellen Geschäftsführer nicht vollständig. Bei Kenntnis von Unregelmäßigkeiten kann Untätigkeit als vorsätzliches Unterlassen (§ 13 StGB) gewertet werden. Damit erweitert sich der Kreis der nach § 266a StGB als Arbeitgeber haftenden Geschäftsführer erheblich. Weitere Grundlagen zur Geschäftsführerhaftung finden sich in unserem Beitrag zur Strohmann-Problematik.
Typische Fallkonstellationen und ihre strafrechtliche Bewertung
§ 266a StGB und der Strohmann-Geschäftsführer als Arbeitgeber
In der Unternehmenspraxis finden sich häufig Geschäftsführer, die lediglich formal bestellt wurden, ohne tatsächliche Befugnisse zu besitzen. Diese „Strohmann-Konstellationen“ werfen besondere Zurechnungsfragen auf.
Die Rechtsprechung zeigt hier klare Tendenzen: Die formelle Organstellung begründet grundsätzlich Überwachungspflichten. Fehlende Kontrollmöglichkeiten können allerdings die Garantenstellung ausschließen. Die bewusste Übernahme einer „Strohmann-Funktion“ schließt eine Entlastung jedoch weitgehend aus.
Für die Verteidigung ist der Nachweis fehlender tatsächlicher Einflussmöglichkeiten zentral. Entscheidend ist die konkrete Ausgestaltung der Unternehmensstrukturen.
Mehrere Geschäftsführer: Wer ist Arbeitgeber nach § 266a StGB?
Bei mehreren Geschäftsführern stellt sich die Frage der Verantwortungsabgrenzung. Eine wirksame Geschäftsverteilung kann die strafrechtliche Verantwortung auf den zuständigen Geschäftsführer konzentrieren.
Eine wirksame Ressortaufteilung setzt eine klare, dokumentierte Zuständigkeitsregelung voraus, die auch tatsächlich befolgt wird. Zudem dürfen keine Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen im fremden Ressort vorliegen.
Aber: Die BGH-Rechtsprechung kennt eine „Residualverantwortung“ – bei evidenten Missständen müssen auch nicht-zuständige Geschäftsführer eingreifen.
Der faktische Geschäftsführer im Hintergrund
Problematisch sind Konstellationen, in denen die tatsächliche Unternehmensleitung durch nicht bestellte Personen erfolgt. Hier konkurrieren formelle und faktische Verantwortlichkeit. Die Bestimmung des faktisch Verantwortlichen bereitet der Rechtsprechung regelmäßig Schwierigkeiten, wie der BGH in seinem Beschluss vom 23.03.2022 – 1 StR 511/21 verdeutlicht hat, in dem die Feststellungen zur faktischen Geschäftsführung als lückenhaft bemängelt wurden.
Die strafrechtliche Zurechnung erfolgt hier mehrschichtig: Der faktische Geschäftsführer kann über § 14 StGB als Täter herangezogen werden. Die Garantenstellung des formellen Geschäftsführers bleibt grundsätzlich bestehen – es sei denn, er war vollständig von Kontroll- und Einflussmöglichkeiten ausgeschlossen.
Der Kolonnenführer als Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB
Eine besondere Konstellation stellt der sogenannte Kolonnenführer dar. Der BGH hat in seinem Beschluss vom 5. Juni 2013 – 1 StR 626/12 klargestellt, dass auch ein Kolonnenführer Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB sein kann, wenn er die tatsächliche Dispositionsbefugnis über die Arbeitsverhältnisse innehat und die Arbeitnehmer in seinen Betrieb eingliedert. Diese Rechtsprechung verdeutlicht, dass nicht die formale Unternehmensstruktur, sondern die tatsächlichen Gegebenheiten entscheidend sind.
Die Vorsatzproblematik bei § 266a StGB
Die subjektive Tatseite erfordert Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale. In der Praxis ergeben sich häufig Nachweisschwierigkeiten.
Vorsatzformen und ihre Bedeutung
Direkter Vorsatz (dolus directus): Sichere Kenntnis der Nichtabführung
- Selten nachweisbar ohne Geständnis oder eindeutige Dokumentation
Eventualvorsatz (dolus eventualis): Billigende Inkaufnahme der Nichtabführung
- BGH: Ausreichend bei Kenntnis der wirtschaftlichen Schieflage
- Kritisch: Grenzziehung zur bewussten Fahrlässigkeit
Irrtumsproblematik
Für die Verteidigung relevant werden insbesondere der Tatbestandsirrtum bei Unkenntnis über Höhe oder Fälligkeit der Beiträge, der Verbotsirrtum bei Fehlvorstellungen über Abführungspflichten sowie der Erlaubnistatbestandsirrtum bei Annahme eines Zurückbehaltungsrechts.
Die Rechtsprechung ist bei der Anerkennung von Irrtümern restriktiv. Von Geschäftsführern wird erwartet, sich über ihre Pflichten zu informieren.
Verteidigungsstrategien in der Praxis
Beweisrechtliche Ansatzpunkte
Die Verteidigung gegen Vorwürfe nach § 266a StGB sollte sich auf den Nachweis fehlender Arbeitgebereigenschaft des Geschäftsführers konzentrieren. Die erfolgreiche Verteidigung bei § 266a StGB erfordert präzise Kenntnis der Rechtsprechung zum Arbeitgeberbegriff. Detaillierte Informationen zur Verteidigung im Wirtschaftsstrafrecht bietet unser Hauptportal.
1. Dokumentation der Organisationsstruktur
Zentral sind Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen, Protokolle über Ressortverteilungen sowie Nachweise über die tatsächlichen Informationsflüsse im Unternehmen.
2. Nachweis fehlender Verfügungsmacht
Hier spielen Kontovollmachten und Zeichnungsberechtigungen eine entscheidende Rolle. Belege über die tatsächliche Zahlungsabwicklung und die Kommunikation mit Steuerberatern oder Buchhaltern können die fehlende Verfügungsmacht dokumentieren.
3. Entlastung durch Kontrollhandlungen
Dokumentierte Nachfragen zur Beitragsabführung, Hinweise an Mitgeschäftsführer oder Gesellschafter sowie die Einschaltung externer Berater können die Erfüllung der Überwachungspflichten belegen.
Prozessuale Überlegungen
Im Ermittlungsverfahren wegen § 266a StGB empfiehlt sich regelmäßig Zurückhaltung mit Einlassungen ohne vollständige Aktenkenntnis. Die frühzeitige Sicherung entlastender Unterlagen zur Arbeitgebereigenschaft und eine Koordination bei mehreren beschuldigten Geschäftsführern sind essentiell.
Die Abgrenzung zwischen Haupt- und Nebentäterschaft kann strafzumessungsrelevant sein. Bei Strohmann-Konstellationen kommt auch eine Strafbarkeit nur wegen Beihilfe in Betracht.
Entwicklungstendenzen und Ausblick
Die Rechtsprechung tendiert zu einer Ausweitung der Geschäftsführerhaftung. Delegation und Arbeitsteilung bieten nur begrenzten Schutz. Die Bestimmung des Arbeitgebers im Einzelfall bleibt mit Unsicherheiten behaftet, insbesondere bei unklaren Strukturen und unklar verteilten Verantwortlichkeiten. Die jüngere BGH-Rechtsprechung zeigt, dass die Gerichte hohe Anforderungen an die Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse stellen.
Gleichzeitig zeigen sich in der Rechtsprechung Ansätze zur Differenzierung: Die Anerkennung faktischer Unmöglichkeit der Pflichterfüllung, die Berücksichtigung von Zwangslagen und die Würdigung tatsächlicher Organisationsstrukturen.
Für die Verteidigungspraxis bleibt entscheidend, die tatsächlichen Verantwortlichkeiten präzise herauszuarbeiten. Die formale Organstellung ist Ausgangspunkt, nicht Endpunkt der strafrechtlichen Bewertung.
Fazit
Die Frage der Arbeitgebereigenschaft bei § 266a StGB erfordert eine differenzierte Betrachtung. Während die BGH-Rechtsprechung grundsätzlich von umfassenden Pflichten des formellen Geschäftsführers als Arbeitgeber ausgeht, bieten sich in der konkreten Fallgestaltung häufig Verteidigungsansätze.
Entscheidend ist die sorgfältige Analyse, ob der beschuldigte Geschäftsführer tatsächlich Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB war. Eine pauschale Haftung kraft Organstellung kennt das Strafrecht nicht – auch wenn die praktischen Anforderungen an eine Entlastung hoch sind. Die aktuelle BGH-Rechtsprechung zum Wirtschaftsstrafrecht zeigt die Tendenz zu strenger Beurteilung der Geschäftsführerverantwortung.
